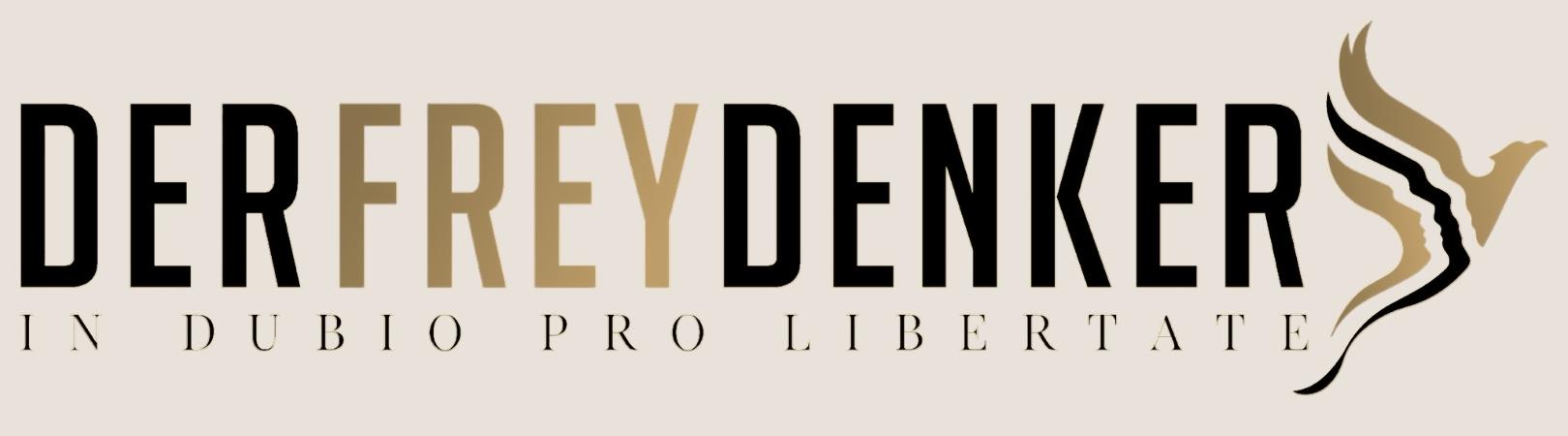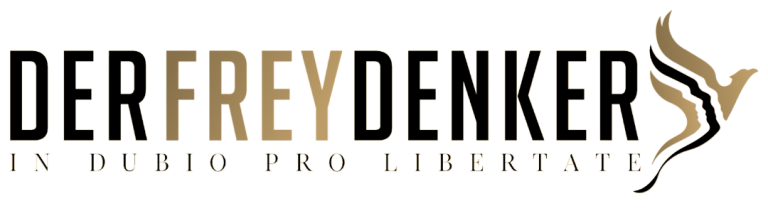Für die einen ist die Europäische Union eine Art genetisch veränderter Super-Leviathan, dessen Lebenszweck darin besteht, Stück für Stück jede Freiheit der Bürger aufzufressen, um sie im großen Brüsseler Stoffwechsel in Herrschaftsinstrumente machtbesessener Bürokraten zu verwandeln. Für die anderen ist die EU der Garant für den Anbruch des Goldenen Zeitalters, nach dem sich die Menschen aller Länder und Zeiten stets gesehnt haben: die Auflösung all unserer Probleme in einer Gemeinschaft wohlwollender und zivilisierter Menschen (… die sich dadurch abgrenzen von den Barbaren im chinesischen Osten und amerikanischen Westen).
Liest man die Äußerungen der Gegner und Apologeten der EU, wird man erkennen: Obige Skizze ist nur marginal überspitzt. Tatsächlich knüpfen sich heftigste Emotionen, Angst und Hoffnung an dieses eigentlich wenig glamouröse Projekt. Bei genauerem Hinsehen stellt man nämlich fest, dass es sich bei der EU in vielerlei Hinsicht um staubtrockene Maßnahmen und hochtechnische Institutionen handelt. Es geht darum, gemeinsam Dinge zu organisieren, wobei man versucht, so viel Nutzen zu stiften, dass der Einspruch gegen eine Maßnahme nicht zu heftig ausfällt. Und all das in einem Umfeld, in dem die Politiker der Mitgliedstaaten, große Unternehmen und Bürokraten um jeden Krümel des Kuchens streiten.
Ganz ehrlich: große Pläne sind unter solchen Umständen zum Scheitern verurteilt. 27 Staaten wie Rumänien, Schweden, Portugal, Luxemburg und Ungarn dazu zu bringen, einen europäischen Bundesstaat zu formen, ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das bedeutet freilich nicht, dass nicht viele der Maßnahmen in der EU, die in Richtung Vergemeinschaftung laufen, trotzdem sehr gefährlich sein können. Das unüberschaubare Kuddelmuddel aus Regulierungen und Kompetenzen, das mittlerweile bei der EU zu finden ist, gefährdet nachhaltig das friedliche Miteinander und den Wohlstand für alle.
Die große Auseinandersetzung liegt deshalb nicht in der Endschlacht zwischen den Verteidigern nationalstaatlicher Souveränität und den Vorkämpfern einer bundesstaatlichen EU. Eigentlich muss es darum gehen, das großartige historische Erbe dieses Kontinents zu bewahren, das ihn zu einem weltweit sichtbaren Leuchtturm von Freiheit, Innovation und Lebensqualität gemacht hat, der seinesgleichen sucht. Das Fundament dieses Leuchtturms bildet das Prinzip der Vielfalt. Oder mit den Worten Wilhelm von Humboldts:
„Gerade die aus der Vereinigung mehrerer entstehende Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut, welches die Gesellschaft gibt, und diese Mannigfaltigkeit geht gewiss immer in dem Grade der Einmischung des Staats verloren.“
Viele Gegner der EU verkennen, dass das ganze Elend, das sie zum Teil zurecht beklagen, seinen Anfang bereits im 19. Jahrhundert genommen hat. Denn die allerlängste Zeit in der Geschichte Europas war der Zentralstaat nicht das beherrschende Modell. Selbst die großen europäischen Reiche vom römischen über das deutsche bis hin zum britischen Empire waren meist bestrebt, Zentralisierung zu vermeiden und eine Vielfalt von Kulturen, Traditionen und Lebensweisen zu garantieren. Duldung und Toleranz waren zentral für deren Zusammenhalt. Und die unterschiedlichen Lösungen, die etwa die Kleinstaaten des deutschen Reiches ausprobierten, führten zu einem Lernprozess durch den Wettbewerb der Systeme.
Erst mit dem Aufkommen des Konzepts der Nationalstaatlichkeit nahm das zentralstaatliche Modell in Europa richtig an Fahrt auf. Armeen und Sozialsysteme waren die Kernelemente
der Nationen. So konnte das große Wir der Nation gegen äußere Bedrohungen zusammenstehen und nach innen das große Wir der Volksgemeinschaft füreinander sorgen. Wer eine Nation schmieden will, tut das am besten in der Esse dieser beiden Ängste: vor übelwollenden Fremden und vor Not und Armut.
Armeen und Sozialsysteme bedürfen zentraler Organisation. Und es ist kein Wunder, dass gerade diese zwei Bereiche in der Debatte über die Zukunft der EU eine Schlüsselrolle spielen. Wer Zentralismus vermeiden will, muss besonders am Ast des Nationalstaats sägen. Wer sich über Brüssel ärgert, sollte nicht als Parole ausgeben „Mehr Macht nach London, Budapest oder Rom!“ Die teilweise oder vollständige Rückkehr zur nationalen Souveränität, wie sie Skeptiker und Gegner der EU fordern, ist nämlich nichts anderes als das, was die Bundesstaats-Freunde auf einer etwas größeren Ebene tun.
Zur DNA des Wunders Europa gehören wesentlich Elemente wie Vielfalt und Flexibilität, Wettbewerb und Kooperation. Und darum muss die Zukunft Europas auf Subsidiarität aufbauen. So steht es auch prinzipiell im Vertrag von Lissabon:
„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“
Der Haken bei der ganzen Sache ist allerdings die in diesem Text vorgenommene Reihenfolge. Denn während der Vertrag die EU (zumindest auf dem Papier) dazu verpflichtet, sich zu rechtfertigen, wenn sie und nicht das Mitgliedsland tätig wird, heißt es weiter: „weder auf zentraler noch auf regionaler noch auf lokaler Ebene“. Dekliniert man das Subsidiaritätsprinzip richtig durch, müsste die Reihenfolge umgekehrt sein. Die vielen unterschiedlichen Lösungen, die dadurch entstehen, ermöglichen Wettbewerb und Austausch von „best practice“-Beispielen. Schlechte Ideen wirken sich nur auf einen kleinen Kreis aus und gute können übernommen werden. Und meistens wissen die Menschen vor Ort sehr viel besser, was sie brauchen als Politiker und Bürokraten in fernen Hauptstädten. Die eigentliche freiheitliche Antwort auf die Zukunft der EU muss deshalb lauten: Zerschlagt den Nationalstaat. Die Stärke Europas lag historisch stets in den kleinen Einheiten — den Städten Flanderns und Italiens, den Fürstentümern Deutschlands, den Kantonen der Schweiz.
Eine EU des 21. Jahrhunderts müsste aus möglichst vielen kleinen Einheiten bestehen, denen möglichst große Kompetenzen zugestanden werden. Entscheidend für das Gelingen dieses Konzepts ist, dass die Einheiten eine überschaubare Größe haben. Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt sein, Konsequenzen aus politischen Entscheidungen klar zuzuordnen und für die Betroffenen spürbar. Bei solchen Größen kennt man sich zwar nicht mehr persönlich, aber man teilt doch ähnliche Lebenswelten und kann den Nutzen oder Schaden von Entscheidungen noch verhältnismäßig gut übersehen. Hier ist das Einfallstor noch schmal für eine Umverteilung, die lauter Sonderinteressen bedient. Hier ist die Kontrolle von Politikern noch relativ leicht durchzuführen, einschließlich der Möglichkeiten, auf sie Druck auszuüben.
Viele europäische Staaten sind eigentlich zu groß, um diese Kriterien zu erfüllen. Ideal sind Länder von der Größe Sloweniens, Litauens oder Finnlands, die 2 bis 6 Millionen Menschen umfassen, und einen verhältnismäßig homogenen Kulturraum bilden. Die meisten größeren Staaten sind freilich in Regionen aufgeteilt, die solchen Kriterien entsprechen: Der Regierungsbezirk Düsseldorf ist etwa so große wie Irland, Katalonien hat etwas mehr Einwohner als Bulgarien und die Lombardei ist etwas bevölkerungsreicher als Schweden.
Eine langfristige Perspektive für die EU muss ein Europa der Regionen sein, nicht der großen Nationalstaaten. Im Sinne echter Subsidiarität müsste nicht nur Brüssel auf manche Kompetenz verzichten, sondern insbesondere auch Paris, Warschau und Madrid. In einem Europa der Regionen würde den kleinen Einheiten ein möglichst hohes Maß an Eigenständigkeit zugestanden. Alle anderen Hoheitsrechte würden hingegen auf jene Einheiten übertragen, wo sie der Bürger real kontrollieren und bestimmen könnte. In vielen Fällen muss es also nicht heißen: zurück zum Nationalstaat, sondern zurück nach Hessen oder Hamburg statt nach Berlin; nach Siebenbürgen statt nach Bukarest; nach Mähren
statt nach Prag.
Wir brauchen eine Europäische Union, in der kleine Einheiten (z.B. Regionen wie Bayern, Wallonien oder Masowien) über ein hohes Maß an Haushalts und Gesetzgebungskompetenz verfügen. Wo sie um die besseren Lösungen mit unterschiedlichen Steuersätzen, unterschiedlichen Regulierungsformen und unterschiedlichen Formen der Bürgerbeteiligung konkurrieren. Wir brauchen eine EU, die nicht nach dem Prinzip „one size fits all“ organisiert ist, sondern es kleinen Einheiten ermöglicht Lösungen zu finden, die ihrer spezifischen Situation entsprechen. Wo sie je nach Bedarf und Fähigkeiten verschiedenen Clubs, d. h. Gruppierungen und Abkommen, beitreten können. Die Eurozone und das Schengener Abkommen haben bewiesen, dass dies funktioniert. Warum sollte man nicht die Möglichkeit, verschiedenen Vereinbarungen und Clubs beizutreten, auf einen weitaus größeren Umfang ausdehnen?
Diese Vielfalt an unterschiedlichen Vereinbarungen ist in der europäischen Geschichte nicht unbekannt. So arbeitete beispielsweise die Hanse, zeitweise der mächtigste Wirtschaftsakteur des Kontinents, auf diese Weise. Die Entscheidungen wurden im Konsens getroffen, waren aber erst nach Genehmigung durch den jeweiligen Stadtrat rechtsverbindlich. In ihrer Urbanität, Offenheit und Handelsorientierung waren die Städte der Hanse Vorläufer unserer modernen Welt. Ihre Organisations und Kooperationsmöglichkeiten könnten als Beispiel für unsere Zeit dienen.
In einem wirklich subsidiären Europa, das aus vielleicht 60 oder 80 kleinen statt 28 ziemlich großen Einheiten besteht, würden europäische Institutionen mehr von Wächtern und Diplomaten bestückt als von Politikern und Bürokraten. Ihre Rolle bestünde darin, die Zusammenarbeit der kleinen Einheiten in verschiedenen Clubs zu koordinieren und eventuell auch eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu koordinieren. Und sie bestünde ganz wesentlich darin, die Einhaltung der vier Grundfreiheiten der Europäischen Union zu überwachen und durchzusetzen. Anstatt neue Vorschriften zu erlassen und neue zentrale Pläne für einen ganzen Kontinent zu entwickeln, hätte der Brüsseler Apparat das Hauptziel, Grenzen und Barrieren abzubauen.
Darüber hinaus wäre die Kommission dafür zuständig, die kleinen Einheiten zu unterstützen, wenn Gruppen von ihnen beabsichtigen, enger zusammenzuarbeiten. Sie könnten bei Verhandlungen zur Seite stehen, wenn z.B. die Lombardei, Tirol und Bayern ihre Sozialversicherungssysteme zusammenführen; wenn Flandern, die Südniederlande und das Rheinland eine gemeinsame Verkehrspolizei schaffen; wenn Aquitanien und das Baskenland ihre Schulsysteme angleichen; oder wenn Regionen aus ganz Europa ihre Verwaltungsgesetze harmonisieren.
Ein solches vielseitiges System wäre für Europa viel vorteilhafter als das derzeitige System aus nationalen Eitelkeiten und Sonderinteressen, und zwar nicht nur, weil es die Tradition ehrt, die Europa im Laufe der Jahrhunderte erfolgreich und stark gemacht hat, sondern auch, weil es für eine Union von Völkern, die durch ihre Wertschätzung der freien Märkte, der Demokratie und der Selbstbestimmung miteinander verbunden sind, viel besser geeignet ist. Es gibt eine Alternative zu einem europäischen Zentralstaat einerseits und einem Rückfall auf Nationalstaaten andererseits. Es ist das Europa der Regionen, das den Bürger wieder zum Herrn über sein Schicksal macht. Wie Friedrich August von Hayek schon 1944 in seinem Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ forderte: „Weder ein allmächtiger Superstaat noch eine lose Vereinigung von ‚freien Nationen‘ muss unser Ziel sein, sondern eine Gemeinschaft von Nationen freier Menschen.“
Dieser Beitrag erschien ursprünglich in unserem Printmagazin zum Thema „Europa“.