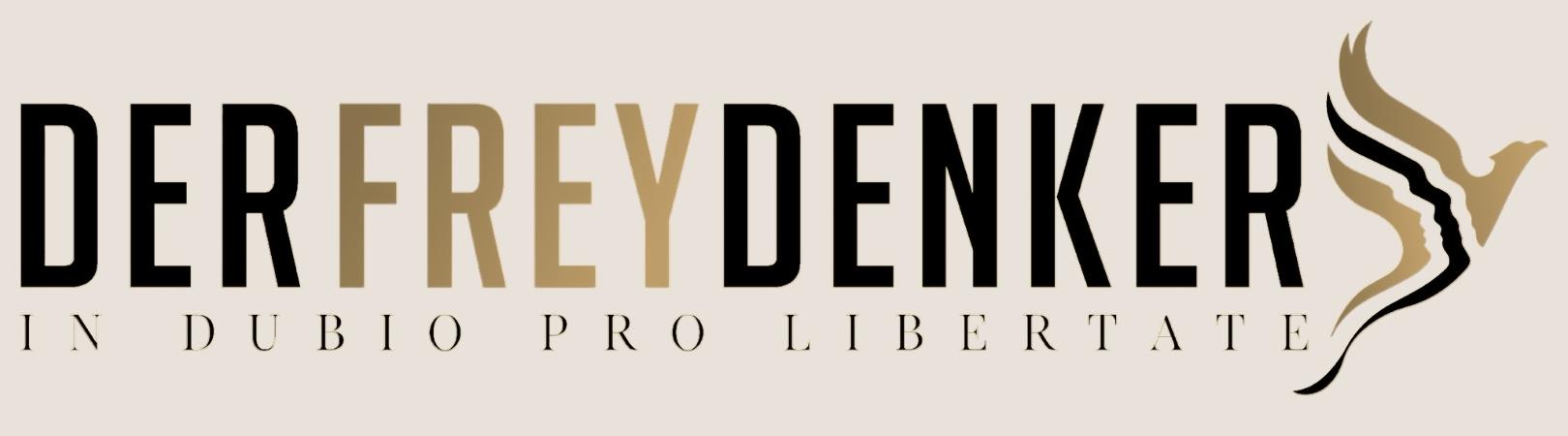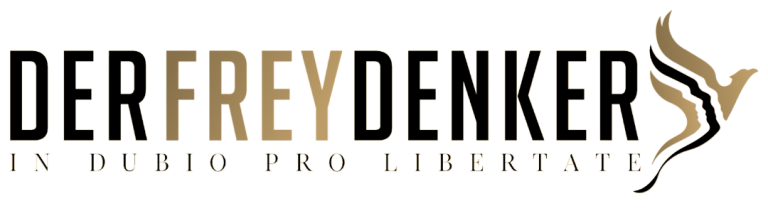Über die Suche nach dem ersten libertären Jugendzentrum Deutschlands, den Suchenden und die Romantik der Freiheit.
Es müsste ein Sommerabend sein. Draußen heiß, drinnen etwas kühler. In die Steinritzen des groben Kellergewölbes würde der Kerzenschein kriechen. Metallene Dartspitzen würden sich mit leisem Plopp in den Kork bohren. Ein letztes mal noch würden die Biergläser geleert. Dann Holz, das über Steinfliesen kratzt. Barhocker würden mit leisem Quietschen ihre Besitzer freigeben. Das Banner würde entrollt werden, groß, stolz, wallend und zwanzig Mann würden sich erheben zu ihrer Mission. Hinaus in Richtung Nacht.
„Jeden Tag bin ich bei eBay Kleinanzeigen. Aber alle wollen ihre Räume nur als Lager vermieten, nicht als Hobbyraum.“ springt mein Gesprächspartner Johannes heraus aus seiner libertären Sommer-Phantasie, zurück in die Realität. Vor sich auf seinem Desktop das kahle Kellergewölbe mit den unverputzen Natursteinen. Kein Kerzenschein, keine Biergläser. Die Barhocker, die Dartscheibe sind im Moment nur als grobe Schemen mit dem Zeichenprogramm in den Kellerraum hinein skizziert. Die zwanzig Mann mit Mission fehlen noch ganz. Bislang kein Mietvertrag für das libertäre Jugendzentrum.
Eine Universitätsstadt im Herzen Deutschlands. Erneut Sommer. Nur diesmal Nachmittag und ganz real. Zwölf Jungliberale meines Kreisverbandes sind Corona-bedingt im Freien zur Sitzung zusammengekommen. Hemden mit Streifen, Pullover in allen Schattierungen von Blau-grau. Jemand ist in Blassrot erschienen. Der Vorsitzende hält eine kurze Ansprache. Er redet über sein Lieblingsthema: Die Organisation und den lokalen MdB. Niemand rollt hier ein Banner aus.
Johannes’ tiefblaue Augen haben sich von seiner Kellerskizze gelöst. Seine Sportkleidung sitzt eng und passgenau über dem schmalen Körper, trotz jahrelangem Krafttraining: „Ich fresse einfach nicht genug.“ Johannes gehört zu jener leidenschaftlichen Sorte Mensch, die naht- und mühelos zwischen akademischem Jargon und vulgären Beschimpfungen springen. Dann wechselt er zurück zur Sachsprache, zum Thema: „Ich habe darüber nachgedacht, wie das kommt. Dass die Linken ihre eigenen Häuser haben, ihre eigenen Kneipen und jetzt auch die Identitären. Warum haben alle das, aber wir Freiheitlichen nicht?“ So beschreibt er den Anfang seiner Suche nach einem Raum. Nicht nach einer Antwort. Aber die Frage bleibt mir hängen, bringt mich zurück zu den Julis.
Wenn mein lokaler Juli-Vorsitzender die einzelnen Arbeitsgruppen und Posten des Kreisverbandes vorstellt, bekommen sie eine fast physische Realität. Sie sind so selbstverständliche, unverrückbare Objekte wie der Cola-gefüllte Plastikbecher in meiner Hand und der Stehtisch, an dem ich lehne. Mein Vorsitzender wird nie vulgär, höchstens noch sachlicher. Hier ist Politik zuerst eine technische Notwendigkeit, die es wie ein Formular abzuarbeiten gilt.
„Ich mag Kunst, die eine gewisse Schaffenshöhe hat, nicht so hingewichst ist. So wie Leonardo da Vinci.“, erklärt mir Johannes und fügt dann nach kurzer Bedenkpause an: „Das klingt prätentiös, das solltest du besser nicht aufschreiben.“ Man merkt Johannes an, dass er Kunst studiert. Aber vielleicht gerade deshalb ist er für diese abendliche Sommerszene in seinem Kopf schon kreuz und quer durch München getourt. Hat in gebügelten Hemden vor netten, älteren Damen gestanden, um seinen libertären Hobbyraum zu ergattern und vor unbeheizten Garagen mit 30 m², nur mit einem Maschendrahtzaun als Tür. Vor seinem inneren Auge steht da längst ein über und über mit Stickern der antikommunistischen Aktion beklebtes Bücherregal: Schwarzbuch des Kommunismus ganz oben. Und alkoholgepeitschte Pogorunden zu Punk haben sich mit melancholischen Gitarrenabenden abgewechselt.
Ich vermute, mein Juli-Vorsitzender hat sich noch nie derartig einen Abend ausgemalt. Er könnte mit dem ungestümen Lebensgefühl von Johannes nichts anfangen. Dieser aufbrausenden Melange aus Gewaltästhetik, Rebellion, Romantik. Er würde nie davon schwärmen, wie der Punk ein „Hilfeschrei“ der Jugend, „gegen eine eingespießerte Gesellschaft“ war. Er würde es vielleicht nie zugeben, aber ich glaube, eigentlich ist mein Juli-Vorsitzender ein überzeugter und auch glücklicher Spießer. Ausgeglichen in seiner ganz unromantischen, pragmatischen Art. Er denkt Politik in ihren kleinen, kontrollierbaren Prozessen, nicht wie Johannes in großen, schlaglichtartigen Bildern, nicht als historische Collage greifbar gewordener Gefühle.
Und vielleicht hat er damit ja auch recht. Aber manchmal frage ich mich, ob nicht Leute wie er genau der Grund sind, dass es keine freiheitlichen Kneipen oder Jugendräume gibt. Und dass wir Freiheitsfreunde irgendwo auf dem Weg durch die letzten hundert Jahre unsere Romantik ganz unbeabsichtigt am Wegesrand verloren haben. Bereit, von zwanzig Männern aus einem Gewölbekeller, mit wehendem Banner, in einer heißen Sommernacht aufgelesen zu werden.