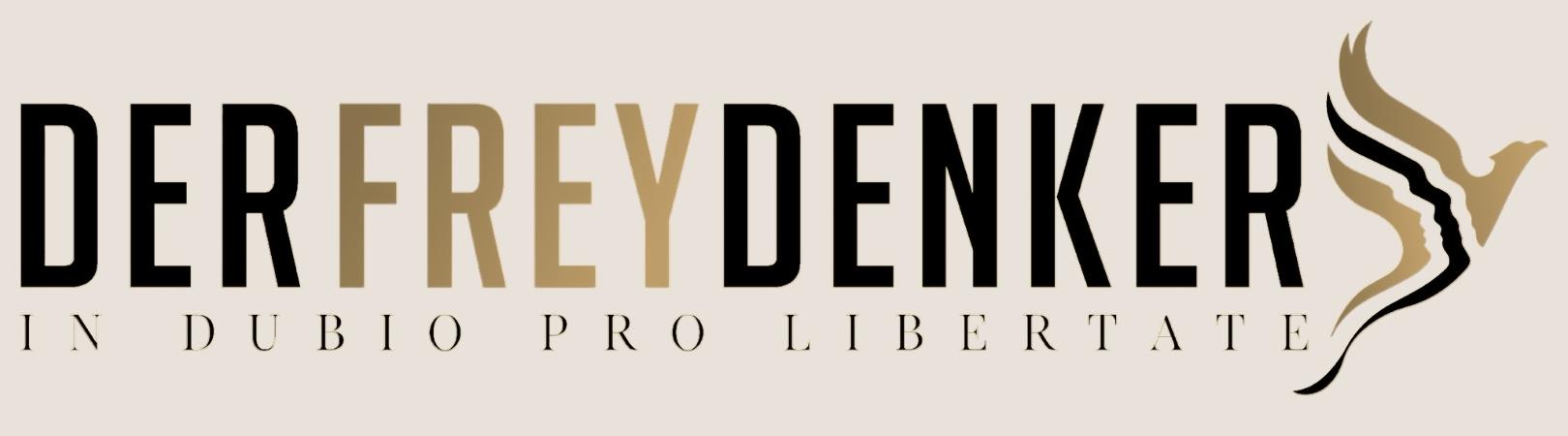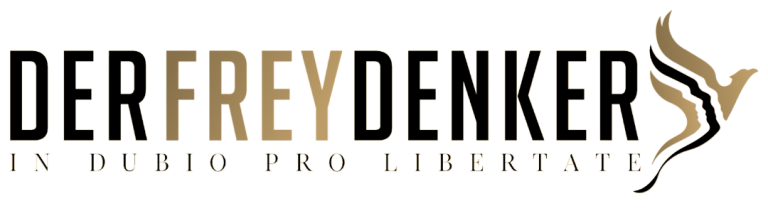Bevor Corona alle Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, gab es wohl keine politischen Themen, die für so viel Wirbel gesorgt haben wie Umweltschutz und der Kampf gegen die globale Erwärmung. Jetzt, wo das Schlimmste überstanden scheint, kommen auch diese Themen bereits zurück. Greta Thunberg und die Fridays for Future protestieren nun bereits seit weit mehr als einem Jahr für die Rettung des Planeten. In zahlreichen Ländern Europas haben Grüne Parteien in letzter Zeit gehörig zugelegt – in Deutschland lagen sie sogar zeitweise in Führung. In den USA hat die Demokratische Partei in vielen Teilen den Green New Deal-Vorschlag von Sozialistin Alexandria Ocasio-Cortez als vielversprechenden Schritt angesehen. Und in Brüssel arbeitet Ursula von der Leyens Europäische Kommission an der Einführung eines eigenen European Green Deal.
All das ist auf den ersten Blick lobenswert. Auch wenn manche Politiker und Experten besonders am rechten Ende des politischen Spektrums gerne den Klimawandel skeptisch gegenüberstehen und sich an Beleidigungen gegen Greta und Co. erfreuen, steht doch fest: die meisten Deutschen, und besonders die Jugend, kümmert dieses Thema mittlerweile sehr – und das ist gut so. Man muss nicht weit aus der eigenen Haustür heraustreten, um den wirklichen Wundern, die es draußen in der Natur gibt, gegenüberzustehen.
Wer viel Zeit in den Bergen, an den Seen, mit den Tieren und in den Landschaften unseres Planeten verbringt, wird sich zweifelsohne zurecht denken, dass diese Schönheiten geschützt werden müssen – für einen selbst, wenn man auf die nächste Wanderung will, aber auch für zukünftige Generationen.
Blickt man dann noch auf den weitestgehend existierenden Konsens unter Naturwissenschaftlern, dass die globale Erwärmung uns in den nächsten Jahrzehnten vor große Herausforderungen stellen wird, so bekräftigt sich der Eindruck, dass dieses Thema zurecht vielen Menschen heute Sorgen bereitet.
Doch können wir uns nicht mit reiner Panikmache oder utopischen Forderungen begnügen. Viel zu oft haben die Gretas und Luisas dieser Welt keine Antworten darauf, wie man die Umwelt schützen und die globale Erwärmung eindämmen kann. Und wenn sie sie haben, dann schlittert es schnell in illiberale oder gar undemokratische Züge ab – wie Gretas Forderungen eines „Systemwechsels“ – oder wird mit traditionell linken Themen vermischt, wie etwa die Forderungen von vielen Klimaaktivisten nach „Klimagerechtigkeit“, einem Stichwort, welches mehr über gesellschaftliche und wirtschaftliche Gerechtigkeit spricht als über das Klima. Davon abgesehen scheinen sich Aktivisten mit bloßen Protesten, mit einer militanten Ablehnung aller politisch tatsächlich realisierbaren Möglichkeiten sowie zivilem Ungehorsam (wie die Extinction Rebellion in Großbritannien, die schon des Öfteren ganze Städte und Flughäfen lahmgelegt hat) zufrieden zu geben.
Politiker reagieren auf Forderungen nach Handlung wenig überzeugend: nämlich stets mit mehr Staat. Die Umwelt kann nur von Brüssel, Berlin oder Washington geschützt werden – und selbstverständlich nicht von den bösen Großkonzernen, Unternehmern oder irgendwelchen gefährlichen Innovationen. Es ist dabei besonders bedrückend, dass Staatsmänner- und frauen wie Markus Söder und Ursula von der Leyen, nominell Mitglieder von konservativen Parteien, einfach nur linke Umweltpolitik machen.
So wichtig es auch ist, den Umweltschutz als ein Thema mit höchster Priorität anzusehen, muss auch genau über die Folgefrage reflektiert werden, statt panisch in unzulängliche politische Programme zu hechten: nämlich, wie man überhaupt am besten unseren Planeten schützt.
Auf der Suche nach der besten Methode des Umweltschutzes wird man tatsächlich eine überraschende Antwort finden: dass es nicht der zentralistische, staatliche Weg ist, sondern die alten liberalen Prinzipien des privaten Eigentums, der Marktwirtschaft und der dezentralen, lokalen Politik.
Die Vision eines marktwirtschaftlichen Umweltschutzes ist dem staatlichen in vielerlei Hinsicht überlegen. Da wäre der Faktor der Eigentümerschaft. Ein freies Wirtschaftssystem basiert auf privaten Eigentumsrechten, also dem Konzept, dass mir dieses gehört und Dir jenes, und dass diese Rechte von staatlicher Seite gesichert und geschützt werden – dass ich mich also verlassen kann, dass das, was ich besitze, mir auch noch morgen gehört.
Für den Umweltschutz hat das enorme Konsequenzen. Wie schon Aristoteles vor mehr als zwei Jahrtausenden feststellte, kümmert sich niemand um das, was niemanden gehört. Besitze ich etwas, so werde ich darauf achtgeben. Und wenn die Ressource aufbrauchbar ist – also irgendwann alle sein könnte – so werde ich entweder nach Methoden suchen, dass sie wiederverwertbar ist oder ich werde sie sorgsam aufbrauchen, über einen langen Zeitraum. Alle diese Fälle sorgen für Nachhaltigkeit. Denn während ich keine Anreize habe, etwas nachhaltig zu verwenden, dass nicht einmal mir gehört, so werde ich ganz anders reagieren, wenn es wirklich meins ist.
Ein prominentes Beispiel dafür sind die US-amerikanischen Bisons. Als die Pilger immer weiter nach Westen expandierten und dort plötzlich Bisons vorfanden, gab es keinerlei definierte Eigentumsrechte über die Tiere. Es kam fast zur Ausrottung, da sowohl Indianer wie auch Pilger möglichst schnell möglichst viele der Bisons erlegen wollten, bevor sie jemand anderes bekam. Warum gibt es heute so viele Bisons in den USA wie seit Langem nicht mehr? Weil Eigentumsrechte definiert wurden – und weil Ende des 19. Jahrhunderts noch die unterschätzte Technologie des Stacheldrahtzauns hinzukam, welche die tatsächliche Ausführung eines Eigentumsrechts ermöglichte. Heute leben Bisons natürlich in (staatlich geführten) Nationalparks. Aber ebenso findet man sie auf privaten Farms.
Ein ähnlicher Fall verzeichnete sich erst in den letzten Jahrzehnten in Südafrika. Breitmaulnashörner waren 1990 fast ausgestorben. Doch ein Gesetz 1991 ermöglichte den privaten Besitz der Nashörner. Heute gibt es mehr als 20.000 Exemplare dieser Tierart – und so sind die Breitmäuler die häufigste existierende Nashornart weltweit geworden.
Der zweite große Faktor, der für marktwirtschaftlichen Umweltschutz spricht, ist die Haftung. Besitzt niemand etwas, aber geht etwas schief, haftet niemand dafür. Man erinnere sich daran, als die US-amerikanische Umweltschutzbehörde 2015 ein toxisches Gift in einen Fluss in Colorado schüttete. Niemand konnte dafür wirklich zur Verantwortung gezogen werden – es war eben die Umweltschutzbehörde und der Fluss gehörte auch niemanden. Doch wenn Eigentumsrechte definiert werden, besteht stets die Möglichkeit, ein Fehlverhalten, welches die Umwelt verschmutzt, auf den Eigentümer zurückzuführen und ihn oder sie zur Verantwortung zu ziehen.
Handel ist der dritte bedeutende Faktor. Werden Eigentumsrechte konsequent definiert, so können diese auch problemfrei miteinander gehandelt werden. Die wichtigen Institutionen der Marktwirtschaft, allen voran das Preissystem, setzen dabei wieder ein und bewerten so unterschiedliche Ressourcen und Güter korrekt. Das ermöglicht es auch für Aktivisten, ihren Protesten echte Taten folgen zu lassen.
Es gibt weltweit tausende sogenannte Land Trusts, die sich einzig damit beschäftigen, Land, welches sie für schützenswert halten, zu kaufen. Die American Prairie Reserve in Montana erwirbt beispielsweise schon seit vielen Jahren immer weiter Eigentum im Osten des Staates mit dem Ziel, eine völlig vor äußeren Störungen geschützte Landschaft zu erschaffen, die größer als die Yellowstone und Grand Teton Nationalparks zusammengerechnet sein soll. Tiere sollen endlich wieder in die Gegend zurückkehren dürfen. Und die Menschen, die die Preserve besuchen würden, sollen mit einer Amerikanischen Serengeti belohnt werden, wie sie Lewis und Clark vor zwei Jahrhunderten in ihrer Reise über den amerikanischen Westen vorgefunden haben.
Privates Eigentum und die Marktwirtschaft sind dem sozialistisch angehauchten Status Quo auch statistisch überlegen. Wer denkt, dass der Staat am besten die Umwelt schützen könnte, muss sich nur an die Sowjetunion erinnern, das umweltverschmutzendste Regime aller Zeiten, welches je nach Region des Imperiums fünf bis zehn Mal so viel Ressourcen verbraucht hat als die westlichen, marktwirtschaftlichen Länder – und so ‚wunderschöne‘ Umweltwunder hervorgebracht hat wie die Tschernobyl-Tragödie.
Selbiges gilt auch für viele Regierungen heute. Die US-Umweltschutzbehörde wurde bereits erwähnt. Doch wieso hält beispielsweise die EU an ihren Agrarsubventionen fest, wenn diese nachweislich in Verbindung mit Nitratbelastung von Gewässern stehen? Wieso hat die EU über Jahrzehnte an einer Fischereipolitik festgehalten, welche die Fischstände Europas fast ans Ende brachten? Und wieso finanzieren Regierungen weltweit fossile Brennstoffe inklusive Erdöl- und gas um zehn Millionen US-Dollar pro Minute, obwohl Berechnungen zeigen, alleine die Abschaffung dieser Subventionen CO2-Emissionen um ein Viertel senken würde?
Blickt man derweil auf den Environmental Performance Index von der Yale und Columbia University, welcher die Umweltsauberkeit von Ländern vergleicht, so lässt sich feststellen, dass die Länder mit freien, auf Märkten basierenden Wirtschaften um knapp 50 Prozent besser punkten als unfreie. Das ist auch über die bereits erwähnten Argumenten hinaus plausibel: In freien Wirtschaften gibt es Unternehmer, die Profit erzielen wollen. So haben sie einen Anreiz mit neuen Innovationen und Ideen aufzuwarten. Das bedeutet nicht nur, dass sie einen Anreiz haben, stets mehr Produkte mit weniger Ressourceneinsatz herzustellen, sondern dass sie auch ihr Augenmerk auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit richten, wenn dies von den Konsumenten nachgefragt wird.
Ist die Marktwirtschaft also ein Allzweckmittel für die Umwelt? Nein, ganz sicher nicht. Aber es gibt keine Allzweckmittel im Umweltschutz. Doch heißt das nicht, dass in diesen Fällen der zentralistische Staat plötzlich wieder aktiv werden müsste. Stattdessen hat sich auch gezeigt, dass zwischen voller Privatisierung einerseits und Verstaatlichungen andererseits noch eine dritte Option besteht: lokale Politik und dezentrale Institutionen.
Eine klassische Tragik in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie ist beispielsweise eine Wiese, die niemandem gehört. Bauern werden auf der Wiese ihre Kühe grasen lassen. Doch eben weil die Fläche niemanden gehört, ist es unausweichlich, dass sie übergrast wird. Die Bauern werden immerhin ihre Kühe solange darauf grasen lassen, bis sie schön fett werden. Da die Fläche weder ihnen noch irgendjemand anderem gehört, schert es sie nicht, was mit der Fläche passiert, solange sie jetzt am meisten davon profitieren und vor den anderen Bauern ihre Chance hatten.
Wie bereits beschrieben könnte das Problem damit gelöst werden, die Fläche aufzuteilen und jedem Bauer ein Teilstück als privates Eigentum anzubieten. Doch funktioniert das in komplexeren Szenarien nicht immer. Die andere Option ist die Fläche zu verstaatlichen oder von oben herab Gesetze und Regulierungen einzuführen – doch damit einhergehend gibt es auch alle Nachteile dieser Methode wie eben erläutert.
Eine dritte Option, wie sie Elinor Ostrom, die erste weibliche Nobelpreisgewinnerin in den Wirtschaftswissenschaften, in zahllosen Fällen weltweit vorgefunden hat, sind lokale Arrangements. In den Schweizer Alpen fand sie beispielsweise Wiesen, die niemanden gehörten und auf denen alle möglichen Kühe grasten. Doch wurden die Wiesen nicht übergrast. Warum? Weil die lokalen Gemeinschaften zusammen gekommen waren und auf freiwilliger Basis Regeln eingeführt hatten, diese Regeln über Generationen sich weiter an die Begebenheiten angepasst hatten und sich in Traditionen entwickelt hatten. Probleme können also oft am besten lokal gelöst werden: dort, wo die Betroffenen und diejenigen mit dem meisten Wissen über die Situation vorzufinden sind.
Für Regierungen heißt all dies, in erster Linie weniger zu tun, um die Umwelt zu schützen. Im Kampf gegen den Klimawandel könnten sie zum Beispiel Steuern auf umweltfreundliche Produkte, Güter und Investitionen kürzen. Oder auf globaler Ebene könnten sie an Freihandelsabkommen für Umweltgüter und -dienstleistungen arbeiten – und die weltweite Aufhebung von umweltschädlichen Subventionen fordern. Das Ziel sollte stets sein: Freiheit für Unternehmer, Innovatoren, Philanthropen und lokale Gemeinschaften erweitern, nicht einschränken.
Es lässt sich sagen: Privates Eigentum, die Marktwirtschaft und Dezentralismus sind dem Sozialismus und staatlicher Einmischung vorzuziehen – auch in der Umweltpolitik. Es ist gerade dieser Punkt, den Greta und Co. noch annehmen müssen, wenn sie für eine sauberere und grünere Zukunft kämpfen wollen.
In seinem im Juli 2020 erschienenen Buch Green Market Revolution argumentiert Kai für eine marktwirtschaftliche Alternative im Umweltschutz.